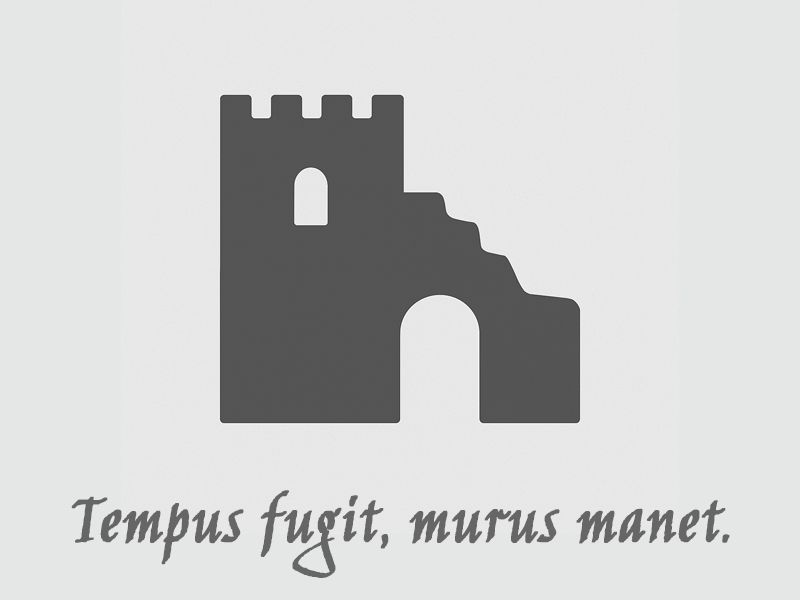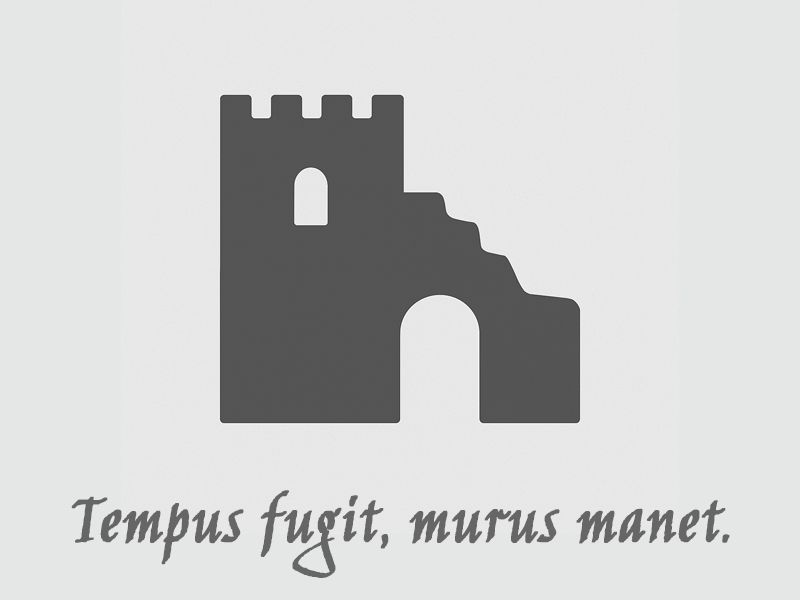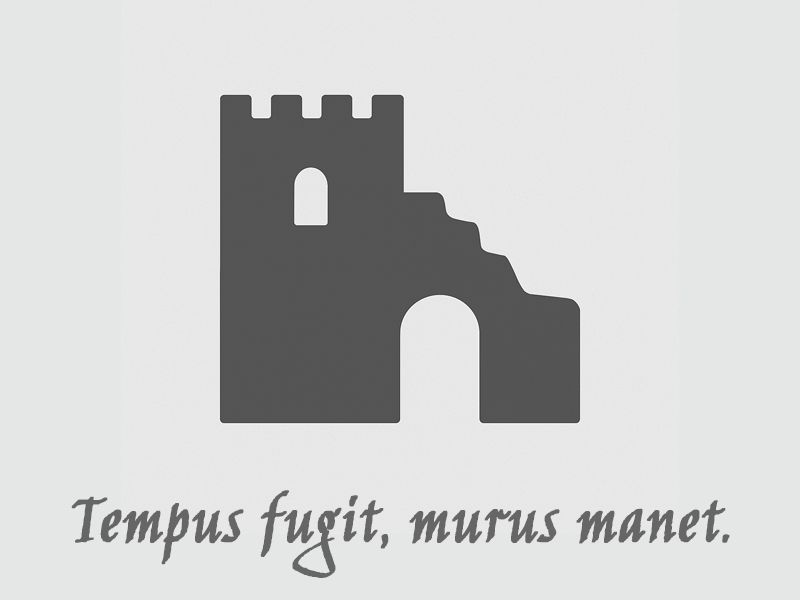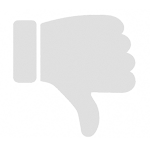 |
 |
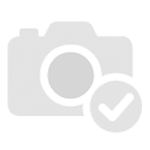 |
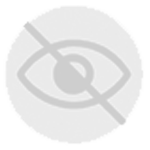 |
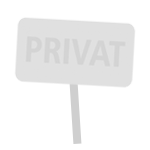 |
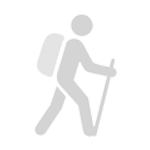 |
| Flop | Empfehlung | Foto möglich | Keine Sicht | Privat | Wandern |
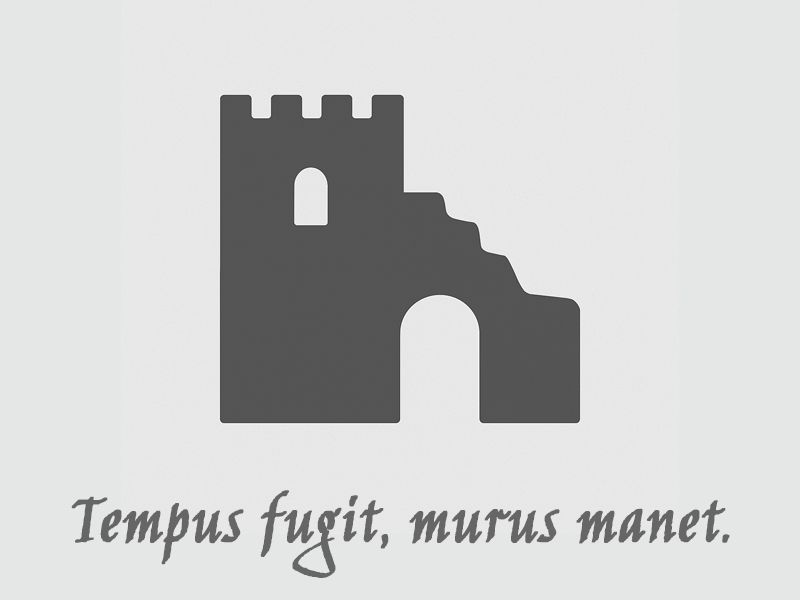
| Touristik & Heiraten | |||||
 | 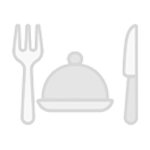 | 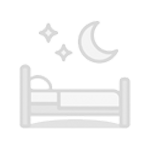 | 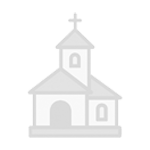 | 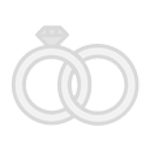 | 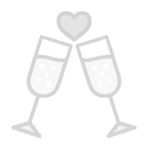 |
| Museum | Gastronomie | Hotel | Kirche | Standesamt | Heiraten |
Die Familie von Hanstein gehörte über Jahrhunderte hinweg zu den einflussreichsten Adelsgeschlechtern im Unteren Eichsfeld. Mehr als 30 Besitzungen befanden sich in ihrem Eigentum, darunter Orte wie Unterstein, Oberstein, Bornhagen, Rimbach, Wahlhausen, Rothenbach, Besenhausen, Hohengandern und Werleshausen. Besonders hervorzuheben ist, dass die Familie sowohl die Hohe Gerichtsbarkeit als auch das Kirchenpatronat über 22 Dörfer innehatte. Ihr Einfluss erstreckte sich somit über weltliche und geistliche Belange. Während der Reformation und Gegenreformation spielte die Familie eine wichtige Rolle. Bekannt wurden insbesondere Burghard von Hanstein, Stiftsherr in Fritzlar und später Propst in Heiligenstadt, sowie Gurt von Hanstein, der 1552 im Auftrag Kaiser Karls V. die Stadt Frankfurt am Main verteidigte – eine Straße dort trägt heute noch seinen Namen.
Die Ursprünge der Burg Hanstein reichen bis ins 11. Jahrhundert zurück. Zunächst im Besitz Ottos von Northeim, wurde sie durch Heinrich IV. zerstört und 1075 von Otto von Northeim wieder aufgebaut, wobei die Oberburg damals noch aus Holz bestand. Über Erbschaft kam der Besitz an Heinrich den Löwen und später an seinen Sohn Kaiser Otto IV. 1209 sicherte sich der Mainzer Erzbischof Siegfried II. Rechte an der Burg. Im Jahr 1308 erhielten die Brüder Heinrich und Lippold von Hanstein die Genehmigung vom Erzstift Mainz, eine neue steinerne Burg zu errichten – allerdings mussten sie die Baukosten selbst tragen. Der Bau zog sich bis 1414 hin; spätere Ausbesserungen lassen sich heute noch an in Steinen eingravierten Jahreszahlen erkennen.
Bis 1476 lebte die gesamte Familie auf der Burg. Die Zeit war geprägt von Spannungen mit benachbarten Fürsten und Städten. An der alten Handelsstraße im Werratal wurde Straßenzoll erhoben. Um die Mitte des 15. Jahrhunderts verfestigte sich das Bild eines rauen Raubritterlebens. Besonders auffällig war Werner von Hanstein, der in ständigen Auseinandersetzungen mit Graf Heinrich von Schwarzburg lag. Auf kaiserlichen Befehl hin musste er das Eichsfeld verlassen und wurde Stadthauptmann in Lübeck.
Im Dreißigjährigen Krieg wurde die Burg 1632 stark beschädigt. Zwar folgten später Reparaturen, doch ab 1683 galt sie als unbewohnbar. Erste Wiederherstellungen betrafen ab 1838 den Saal und das sogenannte Seniorenzimmer. Zwischen 1904 und 1915 fanden weitere Erhaltungsmaßnahmen statt. Seit 1985 wird kontinuierlich an der Sicherung und Restaurierung der Burg gearbeitet, unterstützt von der Gemeinde Bornhagen und dem örtlichen Heimatverein.
Die Architektur der Burg zeugt von beeindruckender Baukunst. Die gotische Anlage beginnt am Burgweg in Rimbach. Dort befand sich einst das erste von insgesamt fünf Toren. Die späteren Tore standen auf Felssockeln mit Schießscharten, die Verteidigung war durch Mauern aus massivem Stein gesichert. Zwischen Tor III und IV ist der sogenannte Neidkopf erhalten, der zum Ludwigstein zeigt. Im inneren Burghof standen einst Wirtschaftsgebäude und ein Denkmal für die gefallenen Familienmitglieder. Das Haupttor V war durch eine Zugbrücke geschützt, links daneben sind noch Reste der Burgkapelle sichtbar.
Die Kapelle selbst war mit einem wertvollen geschnitzten Altar ausgestattet, den Martin von Hanstein 1417 erworben hatte. Heute befindet sich dieser Altar in der katholischen Kirche in Rimbach. In der Kapelle wurden auch Epitaphe für verstorbene Familienmitglieder angebracht. Besonders gut erhalten sind die Darstellungen von Kaspar Rudolph von Hanstein (†1705) und seiner Frau Ursula Maria von Hanstein, geb. von Buttlarin (†1689). Die Epitaphe ihrer Kinder sind hingegen stark verwittert.
Das Innere der Burg war durch mehrere Wohnflügel geprägt, die ursprünglich drei- bis vierstöckig waren und über Treppentürme erschlossen wurden. Kaminreste, Fensterkreuze und Balkenauflagen lassen die Raumstruktur noch gut erkennen. Im Wohnflügel e, der westlichsten Ecke, befand sich das Burgverlies, genannt “Semmelhansloch”. In Wandnischen, ehemals mit Kleeblattbögen verziert, standen vermutlich Heiligenbilder. Zwei Aborterker sind noch gut erhalten.
Vom Burghof aus gelangt man zur Burgterrasse, die früher ebenfalls Wohnzwecken diente. Von dort bietet sich ein weiter Ausblick über das Werratal. Der Zugang zum Palas führt zum ehemaligen Rittersaal und zum 24 Meter hohen Nordturm, dessen Mauern eine Dicke von 1,40 Metern aufweisen. Ein eingelassener Wappenstein von 1519 zeigt die Wappen der Familien von Hanstein und Seebach. Der Aufstieg über die enge Wendeltreppe wird durch den Fernblick bis zum Harz, Ohmgebirge, Meißner und Göttingen belohnt.
Die Restaurierungsarbeiten konzentrierten sich zuletzt auf den Palas, den oberen Rittersaal, den Südturm sowie die äußere Verteidigungsmauer, die auf massivem Fels errichtet ist. Weitere geplante Maßnahmen betreffen die Burgkapelle und die Burgküche. Letztere liegt rechts vom Haupteingang, nahe einem einst 117 Meter tiefen Brunnen, der später auf 20 Meter verfüllt wurde. Noch erhalten sind Kaminreste und steinerne Sitzbänke in Fensternischen.
So bildet die Burg Hanstein mit ihrer bewegten Geschichte, den architektonischen Zeugnissen verschiedener Jahrhunderte und dem Wirken einer bedeutenden Adelsfamilie ein einzigartiges Denkmal der mitteldeutschen Burgenlandschaft.
(gw/ Quelle: Gemeinde Bornhagen)
Lange Zeit ging man davon aus, dass Burg Hanstein bereits im 9. Jahrhundert errichtet worden war und sich im Besitz des Klosters Corvey befand. Heute gilt allerdings als gesichert, dass die Burg erst im 11. Jahrhundert errichtet worden war. 1070 wurde sie nachweislich durch Kaiser Heinrich IV. zerstört. Damals wüteten in der Region die Sachsenkriege, in denen der deutschen Kaiser Stämme unterwarf und so sein Reich erweiterte. Die zerstörte Burg wurde nicht wieder saniert, sondern wenige Meter entfernt an einer anderen Stelle des Burgberges wieder errichtet. Bis das geschah, vergingen etwa 150 Jahre. Erst 1308 begann der Mainzer Erzbischof damit, Burg Hanstein wieder aufzubauen.
Die Burg befand sich unmittelbar an der Grenze zur hessischen Landgrafschaft und spielte daher eine bedeutende, politische Rolle. Da die zu Burg Hanstein gehörenden Dörfer keinen großen Gewinn abwarfen, waren die Bewohner der Burg im 14. und 15. Jahrhundert dazu gezwungen, ihren Unterhalt durch Raubrittertum zu finanzieren. Der Landgraf von Hessen sah sich deshalb gezwungen, seine Grenze mit Burg Ludwigstein zu sichern. Im Dreißigjährigen Krieg wurde die Anlage schließlich weitestgehend zerstört und begann schließlich zu verfallen. Lediglich die DDR nutzte die Burg noch als Wachposten. 1985 begann man damit, die Ruine von Burg Hanstein zu sichern. Seitdem ist sie auch ein beliebtes Wanderziel.
(rh)
Touristisches Gebiet / Region:
- Eichsfeld
- Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal
- Thüringen
Rad- und Wanderwege bei Burg Hanstein:
- Werra-Burgen-Steig (X5 H)
- Hanstein-Rundweg
- Eichsfeldwanderweg
- Leine-Werra-Weg
- P16 (Bornhagen – Burg Hanstein – Lindewerra)
- P17 (Rundweg um die Burg Hanstein)
- Grenzlandweg
- Werra-Radweg
- Hanstein-Route (Radweg)